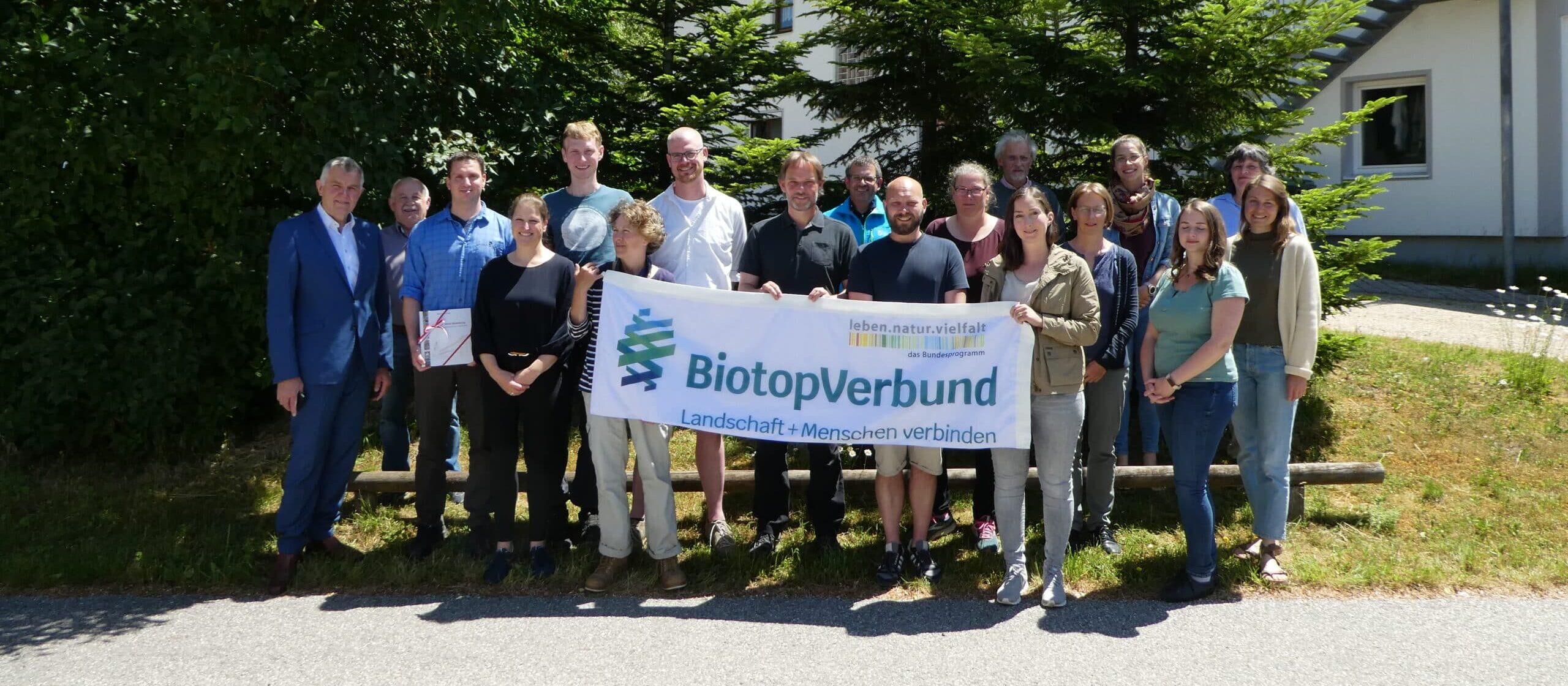Aufbau der Biodiversitätsregion Ostsachsen
Aufwertung von Grünland durch Streuobstbäume in Ostsachsen Streuobstwiesen werten die Kulturlandschaft auf und bieten vielen Arten Rückzugsräume. Foto: IBZ St. Marienthal. Historie Bisher war die Fläche in landwirtschaftlicher Grünlandnutzung mit einer kleinen Bestandspflanzung von Obstbäumen. Problemdarstellung Zur Aufwertung des Grünlandes mit wenigen Obstbäumen wurden kulturhistorisch bedeutsame Obstgehölze zur Herstellung einer Streuobstwiese gepflanzt. Naturschutz ist häufig auf freiwillige Helfer:innen angewiesen (links). Obstbäume aus Baumschulen brauchen nach der Einpflanzung für einen gelungenen Start Stützpfosten (mitte). Birnenbäume sind eine gute Bienenweide mit wenig Ansprüchen (rechts). Foto: IBZ St. Marienthal. Beschreibung der Maßnahmen Im Herbst 2022 wurden 36 Obstbäume auf dem bestehenden Grünland gepflanzt. Diese ergänzen die bestehende Obstgruppe und schaffen ein wertvolles Streuobstwiesenbiotop. In Verbindung mit der extensiven Bewirtschaftung des Grünlandes und der angrenzenden Hecken- und Waldstruktur wird durch die weitere Entwicklung und Pflege ein wertvoller Lebensraum entstehen. Ebenfalls ist für die Zukunft geplant ein "Grünes Klassenzimmer" für Umweltbildungsangebote (Kindergarten, Schulen) zu errichten. Zahlen, Daten, Fakten Maßnahmentyp: Anlage und Pflege einer Streuobstwiese Ziellebensraum: Streuobstwiese Größe des Biotops: 1,0 ha Umsetzungszeitpunkt: 2022 Kooperationspartner: Gemeinde Jonsdorf Ort: Sachsen/Jonsdorf/02796 Rahmenbedingungen Unter großer Hilfe der sehr aktiven Dorfgemeinschaft und weiteren freiwilligen Helfern aus dem Naturpark Zittauer Gebirge konnten über 30 Personen zum Gelingen der Pflanzung beitragen. Kontakt IBZ St. Marienthal Herr Georg Salditt St. Marienthal 10 02899 Ostritz E-Mail: salditt@ibz-marienthal.de Tel.:+49 3582377232