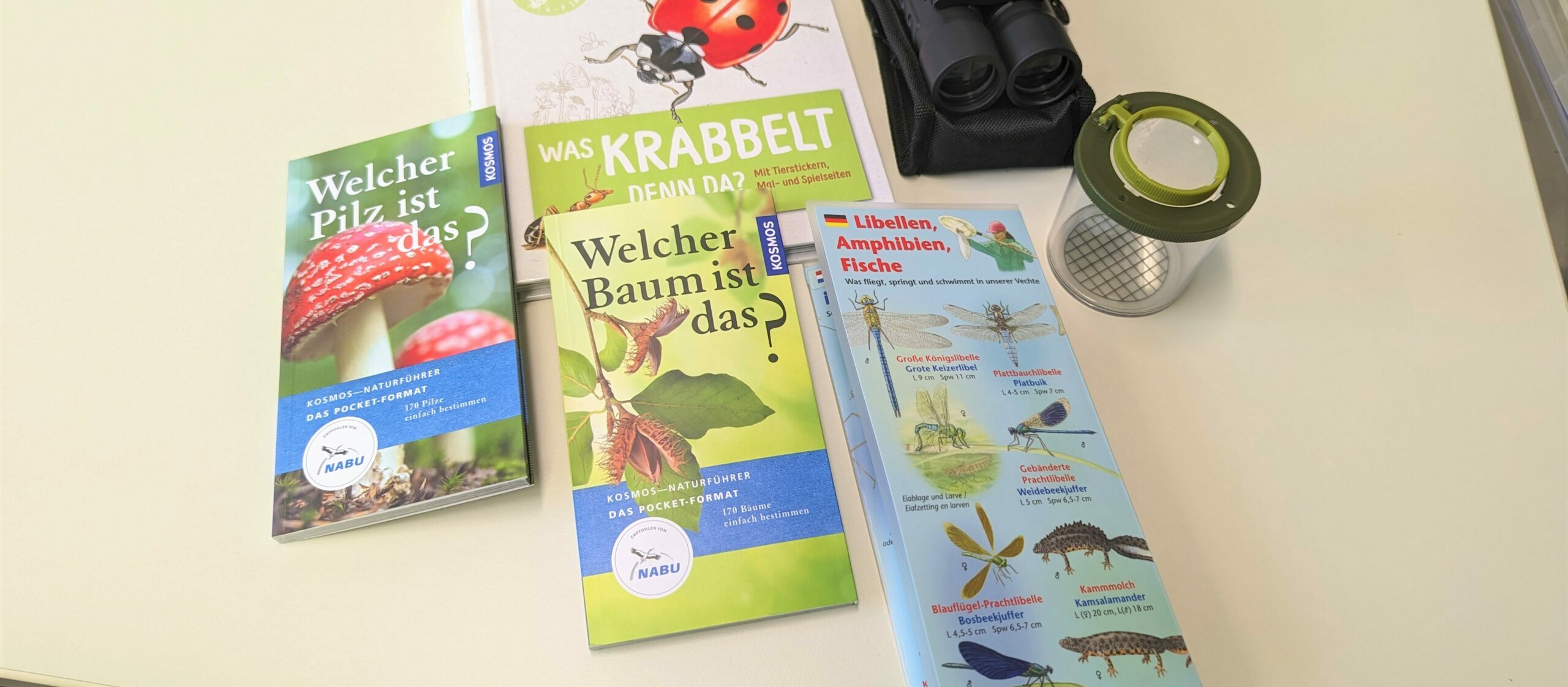Wertvoller Lebensraum auf Rügen geschaffen: BiotopVerbund-Projekt übergibt naturnah gestalteten Dorfteich an die Gemeinde Patzig
Wertvoller Lebensraum auf Rügen geschaffen: BiotopVerbund-Projekt übergibt naturnah gestalteten Dorfteich an die Gemeinde Patzig 08. April 2024 Am Montag, 22. April 2024, laden der Landschaftspflegeverband Rügen e. V. und die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern zur feierlichen Einweihung des neu gestalteten Dorfteichs in Patzig auf Rügen ein. Die ökologische Aufwertung des Teichs wurde im Rahmen des Projekts „Landschaft + Menschen verbinden – Kommunen für den bundesweiten Biotopverbund“ umgesetzt. Irit Vollbrecht, Bürgermeisterin von Patzig, wird den neu gestalteten „Mönchsoll“ vom BiotopVerbund-Projekt feierlich entgegennehmen. Im direkten Umfeld des Teiches wurden nichtheimische und kranke Gehölze wie Fichten und Pappeln entfernt. Alte Kopfweiden entlang des Ufers erhielten einen fachgerechten Pflegeschnitt. Kopfweiden am Mönchsoll in Patzig vor (links) und nach (rechts) dem Pflegeschnitt. Fotos: Landschaftspflegeverband Rügen e.V. Rund 1.265 Quadratmeter Blühwiese wurden um den Teich angelegt und auf circa 390 Quadratmeter heimische Bäume und Sträucher wie Wildapfel und -birne, Weißdorn, Hasel, Schlehe, Wild-Rosen und Johannisbeeren unter anderem gemeinsam mit Jugendlichen der Schule „Rügenwind“ gepflanzt. Auch Stein- und Totholzhaufen wurden errichtet, um geeignete Quartiere für Amphibien, Reptilien und Insekten zu schaffen. Schülerinnen und Schüler der Schule "Rügenwind" helfen aktiv beim Pflanzen heimischer Bäume. Foto: Landschaftspflegeverband Rügen e.V. Zusätzlich erfolgte zur gezielten Besucherlenkung das Anlegen von Wegen, das Aufstellen von Bänken und Naturerlebniselementen wie eine aus Holz geschnitzte 1,20 Meter große Eidechse. Neu gestaltete Tafeln informieren über das BiotopVerbund-Projekt, das Teilprojekt „Inselbiotope“ auf Rügen sowie die Tier- und Pflanzenarten, die vor Ort von den Naturschutzmaßnahmen profitieren. Infotafeln stellen das BiotopVerbund- und das InselBiotope-Projekt vor und geben Informationen zu Tier- und Pflanzenarten. Foto: Landschaftspflegeverband Rügen e.V. Grußworte und Reden halten Heiko Miraß, Parlamentarischer Staatssekretär für Vorpommern und das östliche Mecklenburg, Dr. Stefan Kerth, Landrat von Vorpommern-Rügen, Nora Böhme, Geschäftsführerin Landschaftspflegeverband Rügen e. V. und Vreni Zimmermann, InselBiotope-Projektmanagerin.